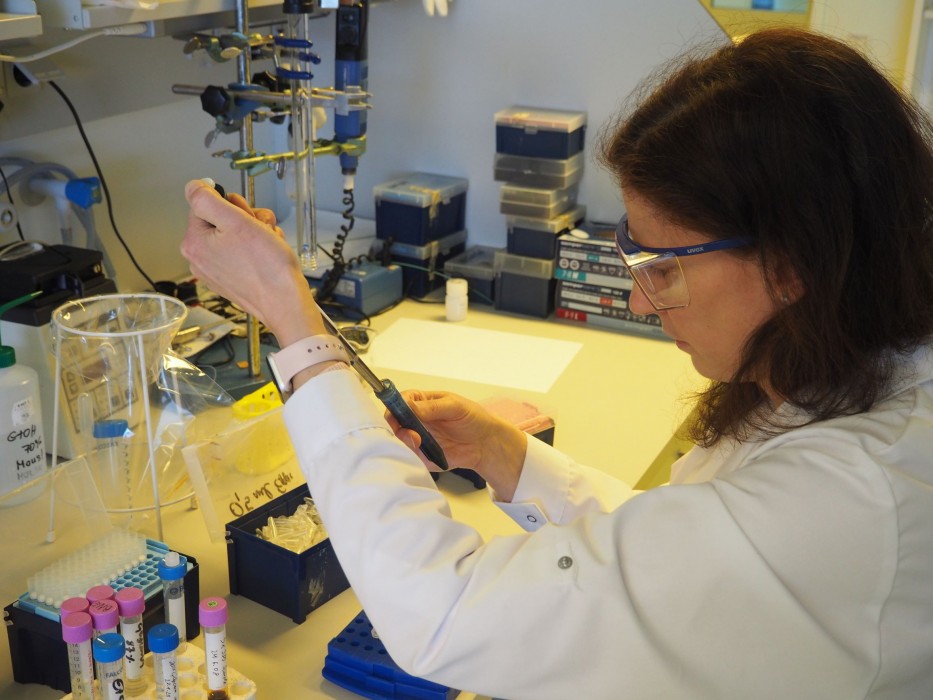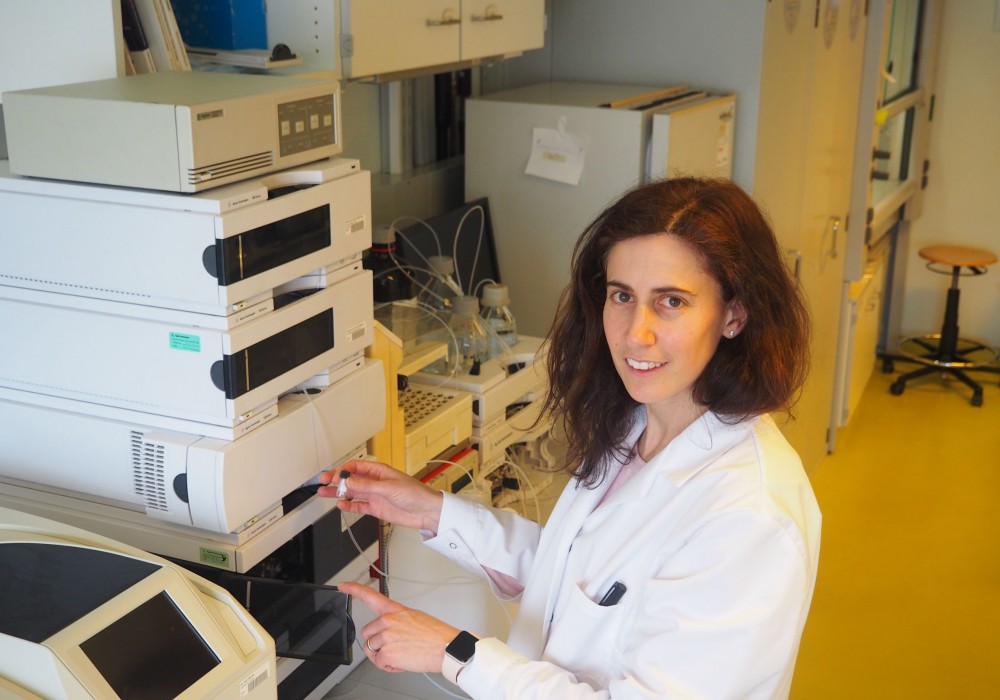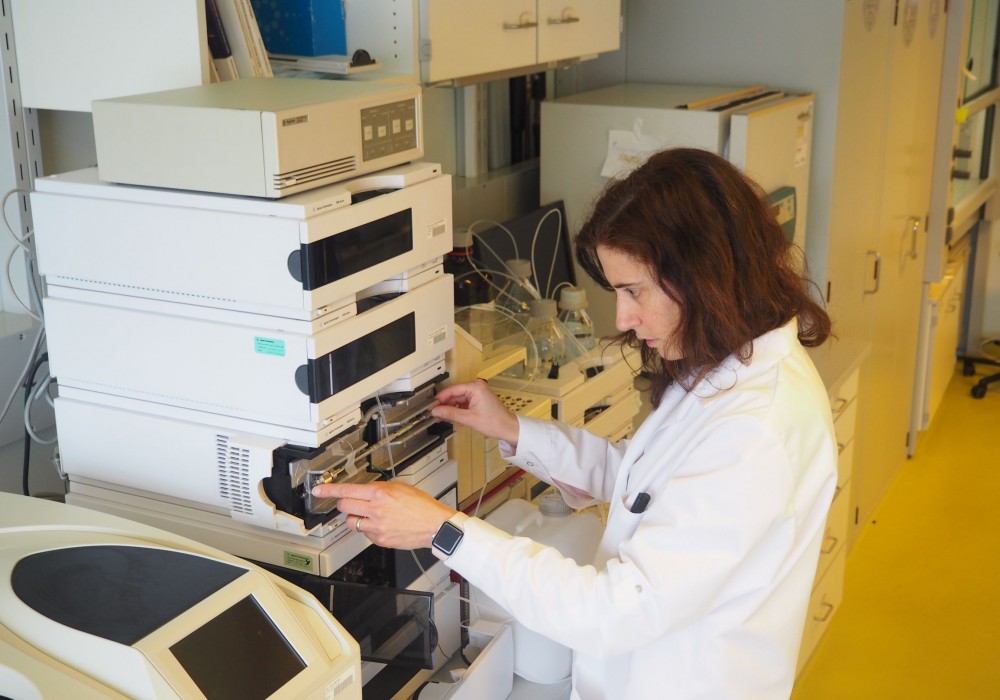Hattest du damals schon das Ziel, in die Forschung zu gehen?
Als ich mit 19 Jahren nach Innsbruck ging, dachte ich, ich mache den Magister, komme zurück und suche mir eine Arbeit. Dann habe ich recht schnell gesehen, dass es in Sexten mit Chemie wohl schlecht aussehen wird (lacht). Das Doktoratsstudium anzuhängen war eine logische Folge. Im zweiten Teil des Studiums hat sich die Biochemie immer mehr zu meinem Feld entwickelt. Die Diplomarbeit ist ein Moment, in dem Weichen gestellt werden. Deshalb habe ich lange überlegt, wo ich sie mache. Ich entschied mich, von der Chemie hin zur Pharmakologie zu gehen. In meiner Diplom- und meiner Doktorarbeit habe ich mich dann intensiv mit Calziumkanälen beschäftigt. Mein Schwerpunkt waren jene im Gehirn. Da geht es um Weiterleitung elektrischer Signale in neuronale Zellen.
Und dann kam es zur Begegnung mit einem ganz besonderen Enzym.
Bei der Erforschung der Calziumkanäle standen elektrophysikalische Messungen stark im Mittelpunkt. Das hat mich irgendwann nicht mehr so interessiert. Ich wollte lieber richtige Biochemie machen. 2007 habe ich mich an der Meduni beworben, wo ich in der Gruppe von Ernst Werner am Biozentrum einen Post-Doc zum Enzym Alkylglycerol Monooxygenase, kurz AGMO, gemacht habe. Über Calziumkanäle ist sehr viel erforscht, es gibt mittlerweile weit über 100.000 Artikel zum Thema. Als Forscher bleibt dir da nur ein Unterbereich.
War das bei AGMO anders?
Über dieses Enzym wusste man kaum etwas. Die Datenbasis spuckte vielleicht zehn Einträge dazu aus. 2010, nach drei Jahren Forschung, ist es uns schließlich gelungen, das Gen für die AGMO zu beschreiben. Vorher war nicht bekannt, wie es auf unserer DNA codiert ist. Andere Forschergruppen haben über Jahrzehnte probiert das herauszufinden. Sie sind daran gescheitert, weil das Enzym sehr instabil ist und sich nicht mittels klassischer biochemischer Protokolle reinigen lässt. Wenn du die DNA nicht kennst, kannst du das Enzym in keinem Organismus und in keiner Zelllinie modulieren. Du kannst auch nicht schauen, ob Menschen auf dem Gen-Abschnitt einen Fehler haben, weil du ihn nicht findest. Wir haben das Problem dann durch eine Kombination von bioinformatischer Suche und einem Zellkulturmodell gelöst. Das war ein signifikanter Fortschritt und hat der ganzen Gruppe einen extremen Drive gegeben. Und irgendwann sagten wir uns, es gibt auch andere spannende Enzyme, deren Genabschnitte man nicht kennt. 2020 haben wir dann das PEDS1-Enzym publiziert. Das ist uns zeitgleich mit einer anderen Gruppe gelungen. Von diesen Erfolgsmomenten leben wir. Die restliche Zeit geht es eigentlich ums Durchhalten.
Was ist faszinierend am PEDS1-Projekt?
Das Enzym gehört wie AGMO zu den Etherlipiden. Eine Unterklasse sind die Plasmalogene. Man weiß, dass diese mit Alzheimer und Parkinson, also häufig vorkommenden Krankheiten, zusammenhängen, wo natürlich viel Forschung gemacht wird. Der Unterschied zwischen den Etherlipiden und den Plasmalogenen besteht in einer einzigen Doppelbindung. Das Enzym, das diese Doppelbindung einfügt, ist eine Desaturase, da haben wir das Gen beschrieben. In unserem Projekt nun schauen wir, wo der Unterschied für einen Organismus ist, wenn alle Etherlipide fehlen oder man nur das Enzym weiter hinten im Stoffwechsel wegnimmt und damit keine Plasmalogene mehr gebildet werden können. Aus dem differentiellen Verhalten können wir ableiten, ob die Etherlipide mit der Einfach- oder mit der Doppelbindung in einem Krankheitsgeschehen eine Rolle spielen. Das alles ist erst möglich, weil wir das Gen kennen. Das ist Grundlagenforschung. Wir tragen Steinchen für Steinchen zusammen.